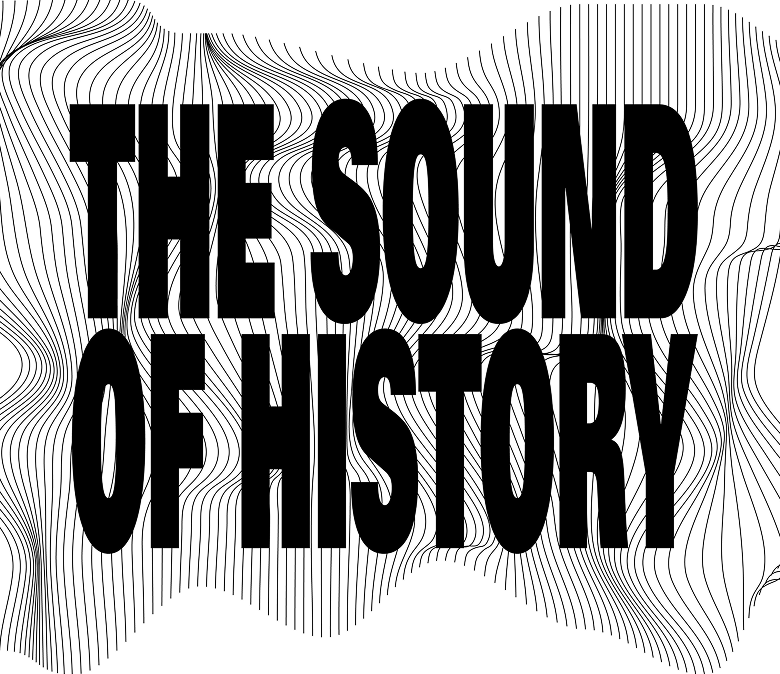
Willkommen zu einer klangvollen Zeitreise!
Tauche ein in über 300 Jahre Musikgeschichte. Erlebe, wie sich Musikausgabegeräte von 1700 bis heute verändert haben und wie sich ihr Klang im Laufe der Zeit wandelte. Ob du lieber hörst, siehst oder liest – du bestimmst den Weg durch die Vergangenheit des Sounds.
1700
Leierkasten

Um 1700 baute Giovanni Barberi in Modena die ersten Drehorgeln, die in Frankreich bis heute „Orgue de Barbarie“ heißen – die „Orgel aus der Fremde“. Mit ihr zogen Musiker durch die Straßen und erspielten sich ihren Lebensunterhalt. Doch mechanische Musik klang nicht nur auf den Gassen: Schon in Kirchtürmen und Salons waren Glockenspiele und kleine Orgeln beliebt. Berühmte Orgelbauer wie Johann Daniel Silbermann fertigten sowohl große Kirchenorgeln als auch kleine Drehorgeln. Auch Komponisten wie Mozart, Haydn und Beethoven schrieben für verwandte Instrumente und schätzten den präzisen Klang der Drehorgel. Sie fand ihren Platz in Opern, Balletten und der Literatur, wurde Unterhalter und Nachrichtenbote. Für viele, wie Kriegsversehrte, war der Leierkasten zudem eine Chance, ihren Lebensunterhalt zu sichern.
1920er
Grammophon

Das Grammophon wurde 1887 von Emile Berliner erfunden und gilt als eines der ersten echten Audio-Ausgabegeräte der Geschichte. Mit seinem großen, trichterförmigen Lautsprecher und der runden, sich drehenden Schallplatte wurde es schnell zum Symbol des modernen Musikhörens. Anders als der Phonograph, der noch Wachszylinder nutzte, setzte das Grammophon auf flache Schellackplatte, auf denen die Musik in feinen Rillen gespeichert war. Das führte zu einer lauteren, klareren und massentauglicheren Wiedergabe.
Zum ersten Mal konnten Menschen Musik zuhause hören, unabhängig von Live-Aufführungen. Das Grammophon legte den Grundstein für unsere heutige Musikkultur und weckt bis heute Erinnerungen an die Anfänge der Klangwelten.
1950er
Plattenspieler

Der Plattenspieler entwickelte sich aus dem Grammophon, das Emile Berliner
erfand. Ab den 1920er Jahren kamen elektrische Antriebe und erste Tonabnehmer auf. Damit wurde die Musik nicht mehr nur mechanisch, sondern elektrisch verstärkt. So war das „Elektrische Grammophon“ geboren. Schellackplatten dominierten bis in die 1950er Jahre. Sie drehten mit 78
Umdrehungen pro Minute und waren weltweit Standard. Erst das robustere Vinyl löste sie ab: mit einer besseren Klangqualität, mehr Speicherkapazität und neuen Formaten wie Langspielplatten und Single. In den 1950er Jahren kamen Plattenwechsler, die mehrere Platten automatisch nacheinander abspielten - eine früher Vorläufer der Playlist. Von den 1920ern bis in die 1960er Jahre war der Plattenspieler das zentrale Abspielgerät für Musik. Erst Kassetten und CDs verdrängten ihn. Doch sein warmer Klang und ikonisches Design feiern heute ein starkes Comeback.
1980er
Walkman

Der Walkman wurde 1979 von Sony erfunden und revolutionierte das Musikhören unterwegs. Entwickelt wurde er auf Wunsch von Sony Mitgründer Masaru Ibuka, der unterwegs seine Kassetten hören wollte. Der erste Walkman, das Modell TPS-L2, war ein tragbarer Kassettenspieler mit Kopfhörern. Er war klein, leicht und batteriebetrieben. Zum ersten Mal konnten Menschen ihre Lieblingsmusik überallhin mitnehmen und ganz privat genießen. Der Walkman wurde schnell zum Symbol der 1980er-Jahre und prägte die Popkultur nachhaltig. Er machte Musik mobil, schuf das Erlebnis des „Soundtracks fürs eigene Leben“ und bereitete den Weg für alle späteren tragbaren Musikgeräte.
1980er
CD-Player

Der CD-Player wurde Anfang der 1980er Jahre entwickelt und markierte den Beginn des digitalen Musikzeitalters. Die Compact Disc (CD) entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Philips und Sony. 1982 brachte Sony den ersten kommerziellen CD-Player, den CDP-101, auf den Markt. Die CD Speichert Musik nicht mehr analog, sondern digital als kleine „Pits*“ und „Lands*“, die von einem Laser abgetastet werden. Mit 44,1 kHz* Abtastrateund 16-Bit-Tiefe* bot die CD einen klareren, rauschfreien klang und war robuster als Schallplatten und Kassetten.
Der CD-Player ermöglichte es erstmals, Musik per Knopfdruck gezielt auszuwählen und ohne Verschleiß immer wieder in gleichbleibender Qualität zu hören. Damit revolutionierte er das private Musikhören in den 80ern und 90ern.
1980er
Handy

Musikstreaming entstand in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren als Folge der Digitalisierung und des Internets. Erste Plattformen wie Napster (1999) ermöglichten den Austausch von Musikdateien, oft illegal. Die Idee, Musik nicht mehr zu besitzen, sondern direkt über das Internet zu hören, wuchs mit schnelleren Verbindungen. Ab 2008 setzte sich legales Streaming durch, als Dienste wie Spotify (gegründet in Schweden) starteten und Musik als Flatrate anboten. Streaming nutzt komprimierte Datenformate wie MP3 oder AAC, die in Echtzeit übertragen werden. Heute ist Musikstreaming der dominierende Weg, Musik zu konsumieren – jederzeit, überall und auf Abruf. Es hat das Musikhören globalisiert, individualisiert und die Musikindustrie komplett verändert.